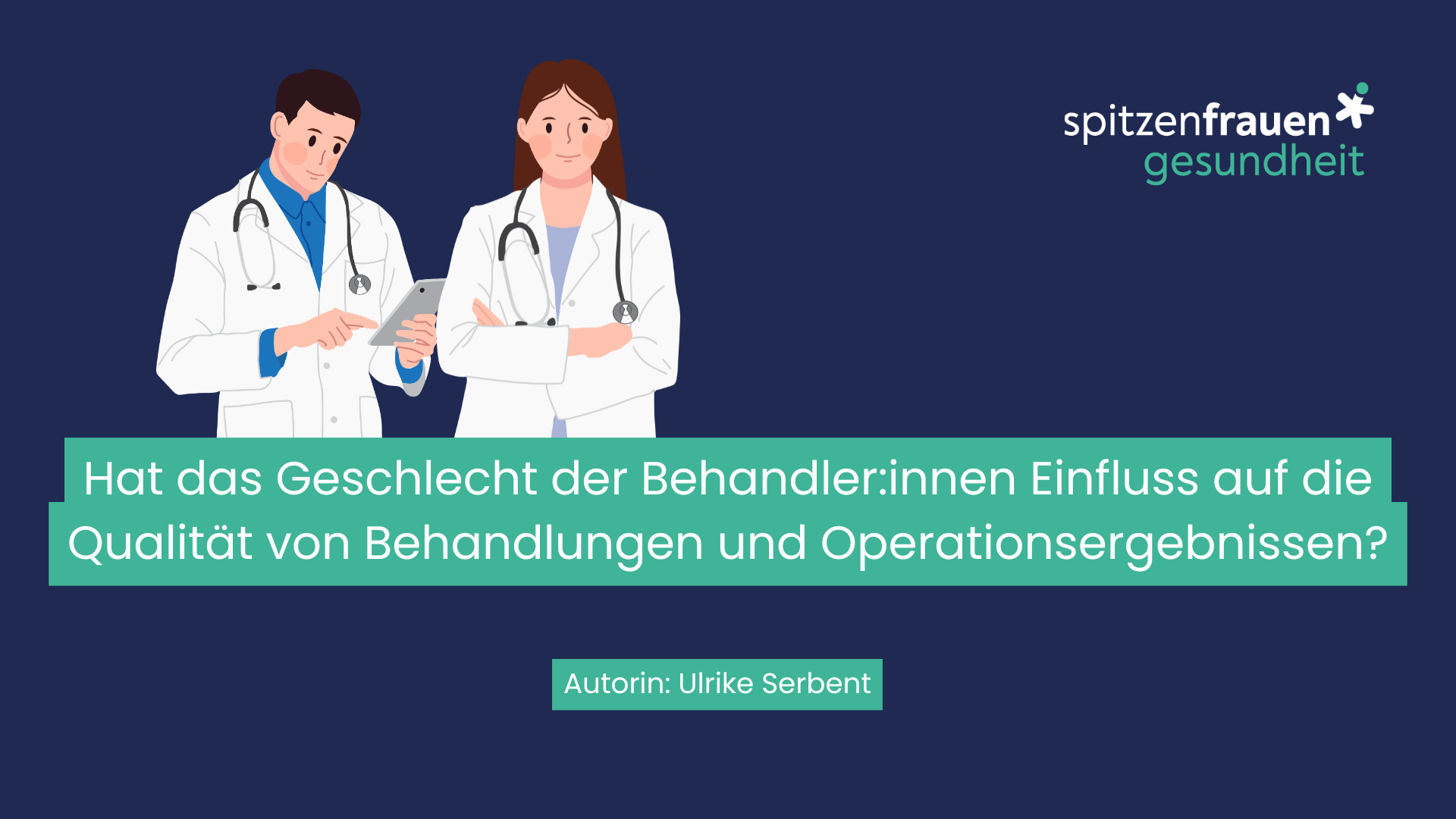
In der medizinischen Forschung wird die Frage, ob das Geschlecht des behandelnden Arztes Einfluss auf die Versorgungsqualität hat, zunehmend und auch kontrovers diskutiert. Eine 2022 in der Fachzeitschrift JAMA Surgery erschienenen Untersuchung* an mehr als 1,3 Millionen Patient:innen beispielsweise ergab, dass Patienten, die von Männern operiert wurden, ein höheres Risiko für Komplikationen und Tod hatten, als Patienten, die von Frauen operiert wurden. Ebenso zeigte eine Studie *2017, dass die Sterblichkeit von Patient:innen, egal ob männlich oder weiblich, wenn sie von Frauen behandelt wurden, mit 11,07 Prozent niedriger lag, als wenn Männer für ihre Therapie zuständig waren – in diesem Fall starben 11,49 Prozent. Auch eine umfassende Studie* der Universität zu Köln, die über 50.000 Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 erfasst hat, lieferte interessante Erkenntnisse. Deren Ergebnisse zeigen, dass Patient:innen, die von Ärztinnen behandelt wurden, signifikant bessere Behandlungsergebnisse erzielten als die, die von Männern betreut wurden.
Die Ergebnisse im Detail
Die Analyse ergab, dass Patient:innen bei Ärztinnen häufiger an Diabetesschulungen teilnahmen und bessere messbare Therapieziele erreichten, unabhängig vom Geschlecht der Patient:innen. Das Ergebnis zeigt, welche Bedeutung eine partizipative Entscheidungsfindung einnimmt, bei der Patient:innen aktiv in den Therapieprozess einbezogen werden. Relevant ist dies besonders bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes, die das gesamte Leben der Betroffenen beeinflussen.
Aber auch weitere Forschungen zeigen, dass Patient:innen, die von Ärztinnen behandelt werden, eine geringere Sterblichkeitsrate aufweisen, vor allem bei bestimmten Erkrankungen wie Nervensystemerkrankungen. Die Studien legen nahe, dass Ärztinnen nicht nur präventiver arbeiten und medizinische Leitlinien besser einhalten, sondern auch empathischer kommunizieren und einen stärkeren Fokus auf die Patienten legen.
Wahrheit oder nur Vermutung?
Es gibt mehrere Hypothesen, warum Ärztinnen oft bessere Ergebnisse erzielen: Dazu zählen Empathie und Kommunikation. Studien belegen, dass Ärztinnen tendenziell mehr Empathie zeigen und eine partnerschaftliche Beziehung zu ihren Patienten aufbauen. Dies kann das Vertrauen und die Therapietreue erhöhen. Dies wirkt sich positiv auf die Behandlungsergebnisse aus. Ein weiterer Punkt ist das Zeitmanagement: Auch wenn die Sprechstundenzeit oft gleich ist, nutzen Ärztinnen diese Zeit möglicherweise effektiver. Sie legen stärkeres Augenmerk auf Aufklärung und Beratung, während männliche Kollegen tendenziell mehr an Untersuchungen und Therapieklarstellungen interessiert sind.
Das Einhaltung von Richtlinien: Es ist bekannt, dass Ärztinnen sich eher an klinische Leitlinien halten und präventive Maßnahmen fokussieren. Auch dies trägt dazu bei, dass Patient:innen seltener in kritische Situationen geraten.
Eine Hypothese besagt, dass männliche Ärzte den Schweregrad von Symptomatik bei weiblichen Patienten möglicherweise unterschätzen. Und diese kann zu Verzögerungen bei der Behandlung führen.
Offene Fragen und weitere Forschung
Trotz der Erkenntnisse bleibt die Frage, ob Frauen die „besseren Ärzte“ sind, weitgehend offen. Die aktuelle Forschung kann bislang nicht vollständig klären, ob andere Variablen, wie z. B. das gesamte sozioökonomische Umfeld, die Versorgungsqualität beeinflussen. Zudem gibt es Unterschiede in der Versorgung durch Männer und Frauen, die häufig nicht mit rein geschlechtsspezifischen Fähigkeiten erklärt werden können.
Ein weiterer Punkt, der beachtet werden sollte: Trotz des Anstiegs von behandelnden Ärztinnen in Praxen und Krankenhäuser, ist der Anteil an Frauen in gestaltenden Führungspositionen im Gesundheitswesen nach wie vor sehr ausbaufähig. Hier spielen strukturelle Aspekte, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ebenfalls eine Rolle.
Fazit: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Behandlungsqualität gibt. Sie sind jedoch nicht einfach mit der Frage „Sind Ärztinnen die besseren Ärzte?“ zu beantworten. Vielmehr zeigt sich, dass Vielfalt in der Medizin entscheidend ist. Verschiedene Perspektiven und Arbeitsweisen können die Patientenversorgung verbessern und bringen letztlich Vorteile für alle Beteiligten, sei es Patientinnen, Patienten oder das Gesundheitssystem insgesamt. Um die Versorgungsqualität weiter zu steigern, sollte sowohl die Kommunikation zwischen Ärztin/Arzt und Patientin/Patient als auch die Berücksichtigung individueller geschlechtersensibler Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen.
Quellen:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34878511/
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2593255
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M23-3163
Autorin Ulrike Serbent
